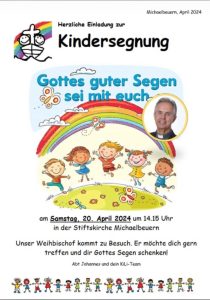Lauf ins Leben!
Laufen hat etwas mit Ostern zu tun: Da wird berichtet, dass die Frauen geschickt werden, um gleich die Botschaft der Auferstehung zu verkünden. Da laufen zwei Jünger, die zum Grab, um sich zu überzeugen, was über diesen Jesus gesagt wurde. Zwei andere laufen davon und erfahren auf dem Weg nach Emmaus, dass Jesus sie unerkannt begleitet. Schließlich sollen die Jünger nach Galiläa vorausgehen, um dort Jesus neu zu begegnen.
Und dann hat diese Botschaft ihren Lauf durch die Welt genommen, weil die Jünger und Jüngerinnen gleichsam gerannt sind, diese Botschaft vom Leben mit Zukunft bekannt zu machen, davon zu erzählen und diese Hoffnung hinauszutragen.
Auferstehung erschließt sich nicht im Grübeln und Sitzenbleiben, nicht in der sicheren Distanz der Unentschlossenheit und der Skepsis, Auferstehung braucht einen Weg (und Zeit, bis sie in uns ankommt) und Auferstehung macht Beine.
Die Auferstehungserfahrung beginnt mit dem inneren Interesse, wie es nach dem Tod weitergeht, was wirklich lebendig macht und bleibt. Zuerst braucht es den inneren Antrieb, sich selber überzeugen zu wollen, das Fragen und Suchen. Wer erfährt, dass das Leben stärker ist als der Tod, dass es Hoffnung für die Zukunft gibt, der muss es einfach bezeugen und weitererzählen.
2000 Jahre nach Ostern: Wer läuft denn da noch, was läuft denn da noch im Glauben?
Im alten Europa sind wir etwas müde geworden, man rennt vielleicht irgendwelchen Messiasgestalten hinterher, die bald verglühen, man rennt dem Erfolg, dem Wachstum hinterher, in vielen Ländern ist ein Rüstungswettlauf zu beobachten. Rennen wir, um eine Antwort auf die großen Fragen des Lebens zu bekommen, laufen wir füreinander, für Menschen, die uns brauchen? Wofür rennen wir?
Ostern ist das große Fest des Lebens, das Beine machen kann, um die Hoffnung nicht untergehen zu lassen, um wieder für das Wesentliche zu rennen. Starten wir durch!
Ein gesegnetes Osterfest!
Abt Johannes Perkmann OSB






 „Wann kommt der Friede, von dem die Engel sangen?“
„Wann kommt der Friede, von dem die Engel sangen?“ 







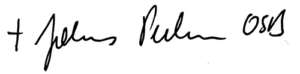

 Liebe Freunde unseres Hauses!
Liebe Freunde unseres Hauses!